archivierte
Ausgabe 4/2022 |

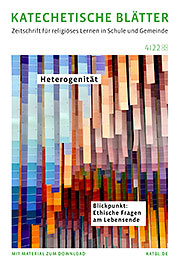
 |
       |
 |
|
|
|
|
 |
|
|
 |
| Helena Stockinger |
| Heterogenität und Verletzlichkeit |
| Menschen sind verletzlich. Dies spielt auch in der Auseinandersetzung mit Heterogenität eine wesentliche Rolle. Wie Heterogenität berücksichtigt wird, ist eng mit Diskriminierungen und dadurch verursachten Verletzungen verbunden. |
 |
 |
|
Heterogenität zu bedenken, ist für viele Pädagog*innen selbstverständlich. Dabei ergeben sich immer wieder Unsicherheiten, wie dies im schulischen oder pastoralen Alltag erfolgen kann. Gerade die Tatsache, dass Menschen in Bildungsprozessen diskriminiert und verletzt werden können, verschärft die Bedeutung, Heterogenität angemessen zu berücksichtigen. Ausgehend von einigen Beispielen aus dem Schulalltag werde ich im Folgenden wesentliche Aspekte des Umgangs mit Heterogenität benennen und einige Reflexionsfragen für die pädagogische Praxis anschließen (vgl. auch Stockinger 2021).
Wer ist normal?
In religionspädagogischen Studien im Gymnasium (Engebretson 2009, Ipgrave 2016, Schihalejev 2010) wird mehrmals eine Situation geschildert, die im folgenden Satz zum Ausdruck kommt: »Über meine religiöse Einstellung spreche ich in der Schule nicht. – Hier ist das Risiko zu hoch, deswegen ausgegrenzt oder ausgelacht zu werden.«
In jeder Interaktion zwischen Menschen spielen Machtasymmetrien und Dominanzverhältnisse, Hierarchien, Status, Privilegien und Ausgrenzungen eine Rolle (Wagner 2010, 215). Diskriminierungen liegen Differenzkonstruktionen zugrunde, wodurch Personen als Mitglieder einer Personenkategorie oder einer Gruppe gelten, für die angenommen wird, dass sie anders als »die Normalen«, »die Mehrheitsbevölkerung « sind (Scherr 2017, 40). Machtverhältnisse sind aus der dominanten Perspektive nicht offensichtlich und lassen sich oft nicht durch einfaches Nachfragen feststellen. Vieles erscheint so normal, dass die Beteiligten Diskriminierungen nicht wahrnehmen.
Daher bedarf es der Reflexion und Sensibilisierung für gesellschaftliche Machtverhältnisse, die sich in den unmittelbaren Beziehungen zwischen Menschen manifestieren. Dies bedeutet, Machtasymmetrien und Dominanzverhältnisse bewusst zu reflektieren, ohne dadurch handlungsunfähig zu werden. (Religiöse) Bildung kann zur Aufrechterhaltung von Machtstrukturen beitragen, weswegen Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen sind: Welche Normalitätsvorstellungen prägen das Handeln in der jeweiligen Einrichtung und die didaktische Gestaltung religiöser Bildungsprozesse? Für wen werden (religiöse) Bildungsmöglichkeiten angeboten? Wie werden Personen berücksichtigt, deren Religionszugehörigkeit, sozioökonomischer Hintergrund, Körperlichkeit, Geschlecht etc. nicht der angenommenen Normalität in der Schule entspricht? Wer wird berücksichtigt, wer wird übersehen? Beispielsweise entsprechen religionsdidaktische Grundentscheidungen häufig dem milieuspezifischen Habitus der Religionslehrer*innen und benachteiligen bestimmte Personen (Altmeyer/ Grümme 2014, 322), ohne dass dies den handelnden Akteur*innen bewusst ist. Die Reflexion des eigenen Selbstverständnisses kann Schulen darin unterstützen, sich zu einem Raum zu entwickeln, in dem Vielfalt »normal« ist.
Wer wird zum »anderen« gemacht?
Eine Lehrkraft spricht einen jüdischen Jungen in der fünften Jahrgangsstufe, die von seinem religiösen Hintergrund nichts weiß, vor der gesamten Klasse im Religionsunterricht an: »Aber du weißt doch darüber mehr Bescheid, du bist doch Jude und kannst uns was darüber erzählen« (Bernstein 2020, 88).
Hier wird deutlich eine Differenz markiert – ohne zu wissen, ob die angesprochene Person in der Klasse mit ihrer Religionszugehörigkeit sichtbar werden möchte. Religion wird von der Lehrperson als Unterscheidungsmerkmal gesetzt und eine Person auf ihre religiöse Identität reduziert. [...]
Lesen Sie den kompletten Artikel in der Printausgabe oder in der Online-Version.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Unsere neue Dienstleistung für Verlage, die ihr Abogeschäft in gute Hände geben wollen.
|

mehr
Informationen
|
 |
|
| Bücher & mehr |

|
|



